Fürsprecher des Parlamentarismus – Moritz Julius Bonn (1873-1965)

Porträt Professor Moritz Julius Bonn (© Bundesarchiv, Bild 146-1990-080-26A)
Moritz Julius Bonn wurde vor 150 Jahren in Frankfurt am Main geboren. Er starb 1965 in London. Moritz Julius Bonn entstammte einer angesehenen jüdischen Bankiersfamilie in Frankfurt. Er wurde als Schüler des Münchener Nationalökonomen Lujo Brentano zu einem der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler seiner Zeit, weil er nicht nur akademisch publizierte, sondern auch öffentlich das Wort ergriff. Man konnte ihn in den großen liberalen Tageszeitungen lesen; viele seiner Bücher erschienen im renommierten S. Fischer Verlag, und er war mit den wichtigsten Denkern und Politikern seiner Zeit gut bekannt. Max Weber hielt große Stücke auf ihn; Theodor Heuss bewunderte den Älteren, den er seit der Jahrhundertwende kannte, und blieb mit ihm zeitlebens befreundet; Thomas Mann ließ sich von ihm die Lasten des Versailler Vertrags erklären; John Maynard Keynes reiste auf Einladung Bonns Mitte der 1920er Jahre nach Berlin und hielt seinen berühmten Vortrag über „Das Ende des Laissez-Faire“.
Im Interview führt der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Jens Hacke in die Gedankenwelt des Nationalökonoms ein, der in den zwanziger Jahren zu den wenigen intellektuellen Fürsprechern des Parlamentarismus zählte.
Herr Hacke, Sie haben vor einigen Jahren damit begonnen, die politischen Schriften von Moritz Julius Bonn dem Vergessen zu entreißen. Wer war Moritz Julius Bonn - und warum lohnt es, ihn und sein Denken gerade heute wiederzuentdecken?
Wenn wir nach großen liberalen Persönlichkeiten im Kaiserreich und in der Weimarer Republik suchen, die Ideen vertreten haben, mit denen wir heute noch etwas anfangen können, dann ist die Ausbeute übersichtlich. Das hängt mit dem Sonderweg eines deutschen Liberalismus zusammen, der Freiheit und Demokratie in der Regel dem Machtstaatsgedanken untergeordnet hat. Es sind vor allem jüdische Intellektuelle gewesen, die gegen den Mainstream gedacht haben. Hugo Preuß ist als linksliberaler Staatsrechtler und einflussreicher Architekt der Weimarer Reichsverfassung wichtig, aber eben auch Moritz Julius Bonn (1873-1965), der sich noch an Bismarck erinnern konnte und Kennedy überlebte. Bonns beeindruckender Denk- und Lebensweg, festgehalten in seiner Autobiographie „So macht man Geschichte?“, fasziniert durch liberale Offenheit, Vielseitigkeit, Weltgewandtheit und die Fülle von Erfahrungen, die darauf beruhten, dass er mit ganz unterschiedlichen politischen Kulturen vertraut war.
Bonns erstes großes Thema war die Kolonialpolitik. In einer Artikelserie der Frankfurter Zeitung kritisierte er die rücksichtslose Niederschlagung des Herero-Aufstands scharf. Er beließ es aber nicht bei moralischer Empörung, sondern argumentierte, dass koloniale Ausbeutung auch marktwirtschaftlich unsinnig ist. Er trat für die Selbstregierung der indigenen Völker ein, besonders in Afrika. Das war nicht nur ein Ergebnis von Schreibtischarbeit, denn er hatte Südafrika und Deutsch-Südwestafrika monatelang bereist und sich selbst ein Bild gemacht. Vorher hatte er schon seine Habilitation über die britische Kolonisation Irlands verfasst, die lange als Standardwerk zum Thema galt. Bonn war polyglott und kosmopolitisch, sprach Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Nach Gastprofessuren in den USA (1914-1917) avancierte er überdies zum angesehensten Amerikaexperten. Der Erste Weltkrieg war für ihn eine Tragödie, nicht nur weil seine Frau Engländerin und weite Teile seiner Familie in Großbritannien lebten. Er exponierte sich früh als Wilsonianer, trat für einen Verhandlungsfrieden ein und forderte demokratische Reformen im Kaiserreich. In den 1920/30er Jahren schrieb er mehrere einflussreiche Bücher über Demokratie und Gesellschaft in Amerika. Ernst Fraenkel, aber auch Harold Laski hielten ihn für den originellsten Amerika-Interpreten seiner Zeit.
Aufgrund der verbreiteten akademischen Diskriminierung von Juden erhielt er nie einen Lehrstuhl an einer ordentlichen Universität und wich an die neugegründeten Handelshochschulen in München und später Berlin aus, die er beide zeitweise als Direktor leitete. Seine große Zeit als politischer Ratgeber, Kommentator und Publizist fiel in die Weimarer Republik. Aufgrund seiner Expertise in weltwirtschaftlichen Fragen gehörte er bereits zur deutschen Delegation bei den Pariser Friedensverträgen. Wie in seinen unbedingt lesenswerten Memoiren nachzulesen ist (und in den Archiven verifiziert werden kann), fungierte Bonn als einflussreicher politischer Berater. Er lieh seine Expertise dem Auswärtigen Amt, der Reichskanzlei und den Wirtschafts- und Finanzministerien. Er war praxisorientiert, befasste sich mit ökonomischen, soziologischen, innen- und außenpolitischen Fragen. Wenn er schrieb und argumentierte, tat er dies mit Wachheit und Common Sense, war zugleich fähig, Problemursachen zu erklären und Lösungen anzubieten. Er war ein brillanter Stilist, ironisch und unterhaltsam, immer geistreich. Es macht immer noch Freude ihn zu lesen, und er demonstriert einem, wie man in turbulenten Zeiten Gelassenheit bewahren kann.
Die Weimarer Republik wird vor allem über ihre revolutionären Anfänge und noch mehr über ihr Scheitern erinnert, das Ausliefern an die Diktatur. Was zeichnet Bonn als politischen Denker dieser Zwischenkriegsepoche aus?
Bonn war ein prinzipienfester und zugleich pragmatisch orientierter Liberaler. Mit dem Blick nach England stand für ihn nicht unbedingt der Sturz der Hohenzollern und damit der Abschied von der Monarchie im Vordergrund, sondern die Etablierung der parlamentarischen Regierungsform. Gleichwohl stellte er sich von Anfang an auf die Seite der Republik. Er war Mitbegründer der linksliberalen DDP, die ja zu Beginn als Partei der demokratischen bürgerlichen Intelligenz beachtliche 18 Prozent der Wählerstimmen in der Nationalversammlung erzielte. Bonn warnte früh davor, die Demokratie mit einem Übermaß an Heilserwartungen zu überfrachten. Er wusste, dass sie sehr schnell für alle aus dem Kaiserreich übernommen Missstände verantwortlich gemacht würde. Die Mechanismen der Massendemokratie und die Usancen harter politischer Auseinandersetzungen hatte er in England und Amerika genau analysiert. Auch deswegen zielten seine Bemühungen vor allem darauf, als politischer Erzieher die Spielregeln demokratischen Auseinandersetzung zu erklären: Gegen Unbedingtheit und Entschiedenheit verteidigte er die Güte des Kompromisses. Gleichzeitig war er früh um die politische Kultur der jungen Demokratie besorgt. Mit der Integrationswirkung des Antisemitismus als politischer Ideologie hatte er sich in einer Artikelserie über den NS 1931 ausführlich befasst; die Anfälligkeit der von sozialem Abstieg bedrohten Mittelschicht hatte er klar erkannt.
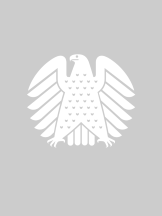
Jens Hacke (© privat)
Moritz Julius Bonn gilt Ihnen als „liberaler Krisendiagnostiker“. Welche Krisen seiner Zeit hatte er im Blick?
Wir neigen mittlerweile dazu, den Krisenbegriff zu inflationieren: Klimakrise, Krise der Demokratie, Krise des Westens, Krise des internationalen Systems usw. Hier lässt sich eine besorgniserregende Analogie zur Zwischenkriegszeit ausmachen – und auch ein nüchterner Ironiker wie Moritz Julius Bonn konnte nicht umhin, seine Epoche als Ära sich überlappender Krisen zu begreifen. Am eindringlichsten entwickelte er seine Zeitdeutung in seinem buchlangen Essay „Die Krisis der europäischen Demokratie“ (1925). Drei Dimensionen sind dabei hervorzuheben:
Erstens nahm er sehr zeitig wahr, dass der Erste Weltkrieg als Erfahrung nicht unbedingt zu künftiger Friedenswahrung und einer generellen Absage an den Krieg führte, sondern dass zu seinen nachhaltigen Folgen Traumatisierung, gesellschaftliche Entwurzelung und Gewaltbereitschaft zählten. Die ideologischen Bürgerkriegsfronten unterhöhlten jede Gemeinwohlorientierung. In Lenin und Mussolini erkannte der Sorel-Leser Bonn Politiker der Gewalt, die gesellschaftliche Ängste und Hoffnungen instrumentalisierten und ideologisch Gewalt legitimierten. Auch die junge parlamentarische Demokratie in Deutschland geriet früh in den Zangengriff von Rechts- und Linksradikalismus. Der radikalnationale Terrorismus der Frühjahre markierte eine ganz neue Dimension des gewaltbereiten Kampfes extremistischer Bewegungen. – Bonn war nebenbei ein Vordenker der Totalitarismustheorie, die erst nach dem zweiten Weltkrieg wissenschaftlich reüssieren sollte. Als Ökonom kreiste sein Denken um die Gewährleistung gesellschaftlichen Wohlstands. Aber er wusste: Nicht die Wirtschaft, sondern die Politik ist das Schicksal – der Kapitalismus brauchte eine Begrenzung durch demokratische Politik. Zugleich musste sich der demokratische Staat darauf einstellen, anders als früher sofort für Krisen in Haftung genommen zu werden.
Damit wurde zweitens deutlich, dass in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der entscheidende Schlüssel zur gesellschaftlichen Befriedung lag, denn wirtschaftliche Notlagen beförderten eine Irrationalisierung der Politik, die extremistische Parteien für ihre destruktiven Zwecke nutzten. Eine verhängnisvolle Krisenverschärfung sah Bonn in der Inflation von 1923, die de facto für eine Enteignung des Mittelstands verantwortlich war und das Vertrauen der politischen Mitte in die Republik untergrub. Für die Weimarer Republik diagnostizierte er allerdings nicht ein Zuviel an freier Marktwirtschaft, sondern eine Feudalisierung des Kapitalismus – also Konzerne, die sich durch Kartelle und Absprachen von demokratischer Politik abschirmen und überdies betriebliche Mitbestimmung verhindern. Als Liberaler sah Bonn in den antidemokratischen Industriekapitänen und wirtschaftlichen Eliten Hauptverantwortliche für die schwierige Lage; die staatstragende Leistung der SPD würdigte er hingegen. Im Blick auf Amerika, das er nicht unerheblich idealisierte, plädierte Bonn für einen demokratischen Kapitalismus, dessen Leistungsfähigkeit Klassenspaltung und soziale Konflikte überwinden sollte.
Drittens besaß Bonn ein genaues Sensorium für weltpolitische Krisenfaktoren. 1926 prägte er bereits den Begriff der „Gegenkolonisation“ und machte die unumkehrbare Tendenz nationaler Befreiungsbestrebungen aus. Er sah im Nationalismus die prägende und potentiell destruktive Kraft seiner Zeit; gerade deshalb musste man sensibel mit den Unabhängigkeitsbewegungen umgehen und für die Kooperation in internationalen Organisationen werben. Bonn war, so könnte man anachronistisch sagen, ein Denker der Globalisierung. Er spürte, dass nationaler Eigensinn zum Atavismus werden musste, und war der Auffassung, dass in Zeiten wirtschaftlicher Vernetzung und kollektiver Sicherheitsinteressen die Stärkung internationaler Kooperation alternativlos sei. Gegen den Nationalismus seiner Zeit stellte er die „Parlamentarisierung“ internationaler Politik – Europa war nach dem Ersten Weltkrieg so geschwächt, dass es seine Interessen nur im Rahmen einer friedlichen Integration verfolgen konnte. Er setzte auf internationale Institutionen und war ein Anhänger der Völkerbundidee, ohne ein naiver Idealist zu sein.
Neben Max Weber als Theoretiker charismatischer Führung und dem Parlamentarismuskritiker Carl Schmitt erscheint Moritz Julius Bonn wie ein Unikum: Er ist als Fürsprecher des repräsentativen Gedankens ein echter Überzeugungstäter. Worin gründet das – und welche Zukunft sah er für den Parlamentarismus?
Bonn war ein großer Bewunderer der angelsächsischen parlamentarischen Tradition und begeisterte sich zugleich für das institutionelle Arrangement der amerikanischen Demokratie. Nach seiner Wahrnehmung befand sich die liberale Idee und die repräsentative Regierungsform keineswegs im Niedergang, sondern beides war in Deutschland gerade erst zum Durchbruch gekommen. Die Geburtswehen der parlamentarischen Demokratie in Deutschland erklärte er, auch im Nachhinein durchaus nachvollziehbar, mit den gesellschaftlichen Verwerfungen der Nachkriegszeit, und er hoffte auf die Ausbildung einer politischen Kultur – eine Art Verfassungspatriotismus, würde man heute sagen. Wie sein Zeitgenosse Hans Kelsen, dessen Ausführungen zu Wesen und Wert der Demokratie (1929) sich mit Bonns Anschauungen im Wesentlichen decken, hielt er Demokratie nur in repräsentativer Form für praktizierbar. Man kann es gar nicht stark genug betonen: Bonn war einer der wenigen politischen Denker, die ohne Wenn und Aber die Vorzüge des Parlamentarismus in jeder Lage verteidigten. Das war auch unter Liberalen keineswegs Standard: Andere liberale Professoren (z.B. Friedrich Meinecke oder Alfred Weber) stimmten in den Chor der Kritiker ein und sinnierten über Führerdemokratiemodelle.
Direkte Demokratie – er hatte die Experimente der Rätedemokratie als „Bürgerrat“ in München erlebt – hielt er für „urgemeindlichen Dilettantismus“. Seinem befreundeten Kollegen Carl Schmitt, den er als Mentor beruflich förderte, indem er ihm zur Professur an der Berliner Handelshochschule verhalf, versuchte er mit gebotener Ironie zu erklären, dass dieser die Prinzipien des Parlamentarismus gar nicht richtig verstanden hatte. Öffentlichkeit und Wahrheit, das waren praxisferne Leitvorstellungen parlamentarischer Deliberation. Nicht nur die Akteure wussten, dass es um Interessen, Aushandlungsprozesse und die Kunst des Kompromisses ging, damit der gesellschaftliche Frieden gewahrt werde. Wichtiger als die Berufung auf die reine Wahrheit oder den wahren Volkswillen sei die Befolgung der Regeln, von der Verfassung bis zur parlamentarischen Geschäftsordnung. Anders als Carl Schmitt, dessen Vorstellung von Demokratie auf der Identität von Herrscher und Beherrschten beruhte und der nationale oder kulturelle Homogenität als entscheidendes Kriterium für ihre Stabilität begriff, war für Bonn der „soziale Pluralismus“ konstitutiv für den freiheitlichen Staat, der Minderheiten schützen musste. Als Jude kannte er sich mit der Tyrannei und dem Konformismus der Mehrheit aus. Abgesehen von religiösen oder ethnischen Minderheiten unterlagen aber die Auffassungen der demokratisch unterlegenen Minderheiten generell besonderem Schutz. Seine Forderung nach Toleranz und sein Lob der Vielfalt bewegte sich ganz auf den Spuren John Stuart Mills.
Von Max Webers Überhöhung der demokratischen Führerschaft hielt er wenig. Anders als der Tragiker Weber stand Bonn auf dem Boden der Moderne und wollte keineswegs auf den großen Charismatiker warten, der „das eherne Gehäuse der Hörigkeit“ aufbrach. Den Kulturpessimismus, der die Durchschnittlichkeit der Politikerklasse beklagte, machte er nicht mit und ironisierte die Sehnsucht nach dem Übermenschen an der Macht. Das Parlament als Schaubühne für die Auslese der Führungspolitiker zu halten, wäre ihm kaum eingefallen – zu klar sah er die sich abzeichnenden Funktionen des arbeitenden Parlaments in den Ausschüssen; außerdem kannte er im Unterschied zu Weber die praktische Regierungs- und Verwaltungsarbeit in den Ministerien aus eigener Anschauung. Die Konkurrenz von präsidentieller und parlamentarischer demokratischer Legitimität konnte Bonn kaum gutheißen – er votierte für die parlamentarische Verantwortung und sah den wesentlichen Mangel darin, dass die Volksvertretung nicht bedingungslos dazu gezwungen war aus sich selbst heraus Mehrheiten zu bilden. Diese Notwendigkeit (ohne die Hintertür der Reichspräsidentenvollmachten von Kanzlerernennung, Parlamentsauflösung, Notverordnungen etc.) hätte die Parteien dazu gebracht, nicht allein ihre „Weltanschauung“ wie eine Monstranz vor sich herzutragen, sondern politische Lösungen zu finden.
Parlamentarische Regierung verlangt Lernprozesse, und Bonn musste darum bangen, ob dazu in den Krisenzeiten der Weimarer Republik Wille und Raum blieb. Er hielt aber an der Überzeugung fest, dass die repräsentative Demokratie, in deren Zentrum die mündigen und selbständigen Bürgerinnen und Bürger stehen, als Regierungsform für eine komplexe, arbeitsteilige und pluralistische Gesellschaft alternativlos blieb. Seine nimmermüden Auseinandersetzungen mit dem Faschismus, dem Leninismus und autoritären ständestaatlichen Überlegungen führte er in dem Bewusstsein, dass die liberale Demokratie nie am Ziel sei, sondern sich immer aufs Neue bewähren müsse.
Was würde der Krisendiagnostiker Bonn über unsere Zeit sagen, auch mit Blick auf den Parlamentarismus heute?
Am meisten würde Bonn vermutlich die Übermoralisierung der Politik aufstoßen. Für die Rituale politischer Rhetorik und die ständigen Empörungsgesten hätte er wenig Verständnis; stattdessen begriff er politisches Handeln als konkretes Problemlösen. Vermutlich würde er sich der Tendenz entgegenstellen, immer mehr Entscheidungsbefugnisse in die Exekutive auszulagern und dem Parlament zu entreißen. Als enthusiastischer Anhänger des Westminster-Parlamentarismus wären ihm Initiativen willkommen, die die Debatten beleben und der starken Formalisierung entgegenwirken. Auch über die gesetzliche Regelungswut und die Aufblähung der Verwaltungsapparate hätte er gewiss Kritisches zu sagen.
Die Linie von Bonns pragmatischem Liberalismus ist womöglich am ehesten von Ralf Dahrendorf fortgesetzt worden. Anglophilie, das Changieren zwischen sozialliberalen und marktwirtschaftlichen Ansätzen je nach Lage und der Respekt für die sozialdemokratische Tradition, die jeden neoliberalen Dogmatismus unmöglich macht: Diese Haltungen verbinden die beiden Liberalen ebenso sehr wie ihr Talent für politische Essayistik, gekoppelt mit der Gabe, komplexe politische Probleme mit Common Sense verständlich zu machen. Beide wussten auch, dass gesellschaftliche Freiheit von außenpolitischen Lagen abhängt und dass die Sicherung individueller Bürgerfreiheiten mit einem kosmopolitischen Engagement einhergehen sollte. Da Bonn zu den vehementesten Kritikern der Appeasementpolitik in den 1930er Jahren zählte und nach dem Zweiten Weltkrieg sehr früh die Einigung Westeuropas anmahnte, lässt sich leicht mutmaßen, dass er sich auch in der heutigen Zeit als entschlossener Verteidiger des Westens gezeigt hätte. Das Eintreten für die liberale Demokratie ist nie mit dem geringsten Übel einer Mainstreamposition zu rechtfertigen, sondern benötigt immer neue anspruchsvolle Begründungen, um sie als komplexes Arrangement aufrechtzuerhalten und zu verteidigen.
Prof. Dr. Jens Hacke lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Politische Theorie und Ideengeschichte. Er ist Autor u.a. von Philosophie der Bürgerlichkeit. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006; Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit, Suhrkamp, Berlin 2018 (3. Auflage); Liberale Demokratie in schwierigen Zeiten. Weimar und die Gegenwart. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2021
Zum Weiterlesen:
Moritz Julius Bonn: Zur Krise der Demokratie. Politische Schriften in der Weimarer Republik 1919–1932. Hrsg. von Jens Hacke. de Gruyter, Berlin/Boston 2015.
Moritz Julius Bonn: So macht man Geschichte? Bilanz eines Lebens. Mit einem Nachwort von Jens Hacke. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2023.
(Inhaltlich verantwortlich: Fachbereich WD 1)